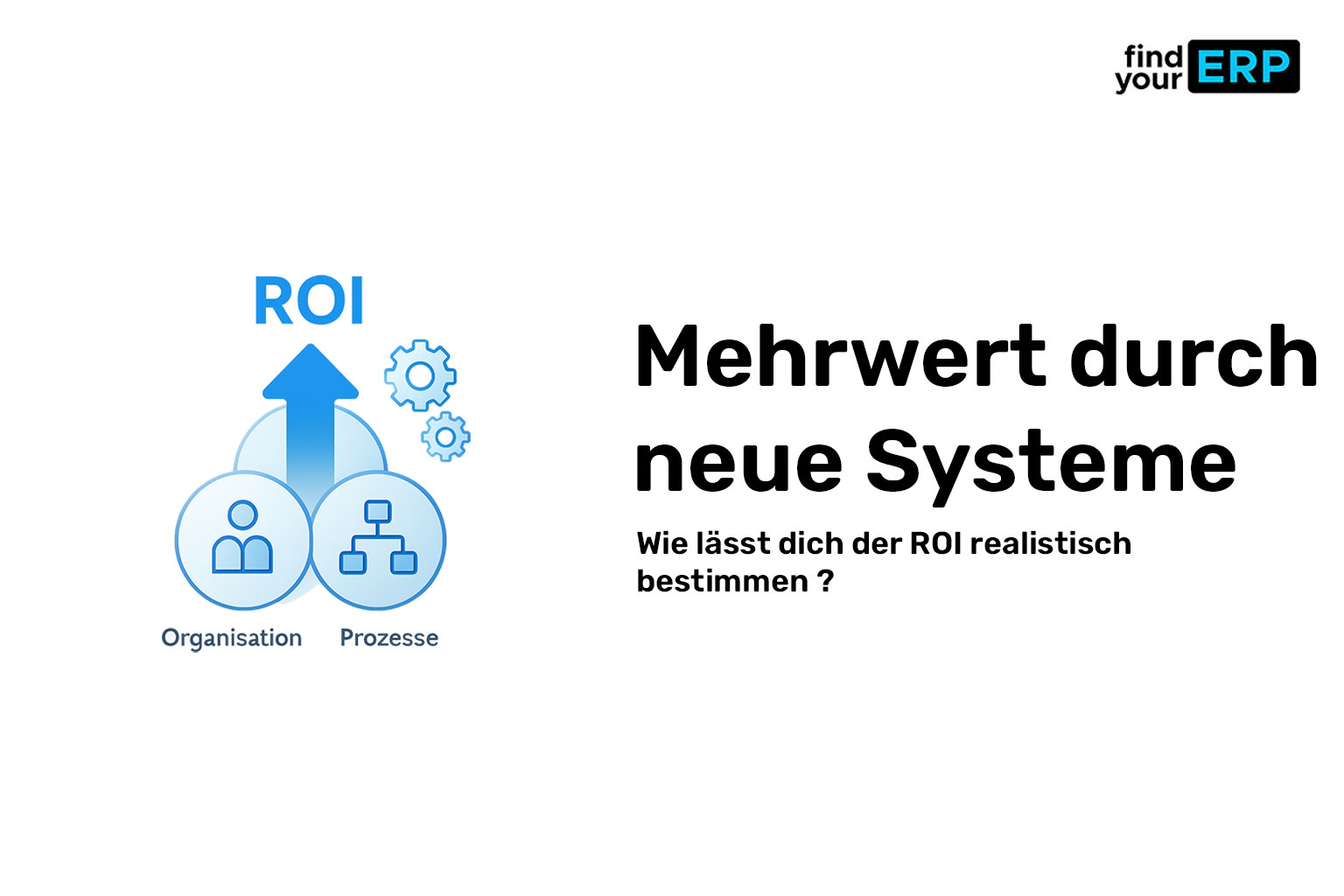Kernaussagen
- ROI in ERP-Projekten ist kein Finanzwert, sondern ein Maß für organisatorischen Fortschritt.
- Der größte Hebel liegt in Prozess-, Funktions- und Strukturpotenzialen – nicht in reinen Einsparungen.
- Unterschiedliche Systeme und Betriebsmodelle eröffnen unterschiedliche ROI-Profile.
- Der ROI entsteht nur durch tatsächliche Veränderung – nicht durch Planung allein.
- Externe Expertise hilft, Potenziale objektiv zu bewerten und realistisch zu hebeln.
Warum der ROI in ERP-Projekten oft falsch gedacht wird
Wenn Unternehmen über den „Return on Investment“ (ROI) eines ERP-Projekts sprechen, geht es erstaunlich oft um Zahlen – nicht um Wirkung. Tabellen mit Investitionssummen, Lizenzkosten und kalkulierten Einsparungen entstehen schnell. Doch selten spiegelt diese Art von ROI-Berechnung den eigentlichen Mehrwert eines neuen Systems wider.
Denn die Einführung eines ERP-Systems ist keine klassische Investition mit kurzfristigem Payback, sondern eine organisatorische und strukturelle Weiterentwicklung des Unternehmens. Der ROI entsteht nicht in Excel, sondern im Zusammenspiel von neuen Möglichkeiten, gelebter Veränderung und tatsächlicher Nutzung dieser Potenziale [1].
Ein häufiger Denkfehler liegt darin, den Nutzen in „Personaleinsparungen“ oder „Zeitgewinnen“ zu beziffern. Das klingt greifbar, verkennt aber die Realität: In der Praxis werden freiwerdende Kapazitäten selten abgebaut, sondern verschieben sich auf wertschöpfendere Tätigkeiten. Ein modernes System entlastet nicht, um Stellen zu streichen, sondern um Wachstum, Qualität und Geschwindigkeit zu ermöglichen. Diese Opportunitätspotenziale sind der wahre Kern des ROI [2].
Ebenso entscheidend: Der ROI kann nur ausgehend von der heutigen Situation bestimmt werden – mit Blick auf Organisation, Prozesse und das bestehende System. Nur wer versteht, wo heute Reibung, Medienbrüche oder manuelle Aufwände entstehen, kann den Mehrwert einer neuen Lösung realistisch einschätzen. Und dieser Blick muss integriert erfolgen: Prozesse, Organisation und Technologie bilden ein gemeinsames System.
Was dabei häufig übersehen wird: Der ROI hängt auch vom jeweiligen System ab. ERP A bietet nicht denselben Hebel wie ERP B. Unterschiede in Funktionsumfang, Integrationstiefe oder Automatisierung können die erreichbaren Potenziale erheblich verändern. In einer frühen Phase kann man mit einem gedachten Zielzustand arbeiten – also einem Referenzbild, was ein modernes System leisten kann. Spätestens im Auswahlprozess sollten die verbleibenden Systeme dann individuell auf ROI-Potenziale geprüft werden [3].
Und selbst die beste Kalkulation bleibt theoretisch, wenn die organisatorischen und systemischen Veränderungen später nicht umgesetzt werden. Neue Prozesse, Rollen oder Automatisierungen entfalten ihren Nutzen nur, wenn sie tatsächlich eingeführt und gelebt werden. Ein Projekt kann den ROI also nur dann heben, wenn die Organisation bereit ist, ihr Verhalten zu verändern [4].
Schließlich sollte der ROI nie isoliert durch das Projektteam ermittelt werden. Der Blick von außen – etwa durch erfahrene, unabhängige Berater – hilft, realistische Annahmen zu treffen und blinde Flecken zu vermeiden. Gerade bei ERP-Projekten, die tief in Strukturen und Routinen eingreifen, braucht es Erfahrung darin, Potenziale richtig zu bewerten, ihre Machbarkeit einzuschätzen und sie mit Kennzahlen zu hinterlegen.
So wird aus der ROI-Betrachtung keine Rechenaufgabe, sondern ein strategisches Instrument: Sie zeigt, wo echte Mehrwerte liegen – und welche Veränderungen nötig sind, um sie zu realisieren.
Der richtige Ausgangspunkt – Die heutige Situation verstehen
Jede ROI-Betrachtung beginnt mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme: Wo steht das Unternehmen heute – organisatorisch, prozessual und systemisch?
Nur wenn diese drei Ebenen zusammen betrachtet werden, entsteht ein realistisches Bild der möglichen Verbesserungen.
In vielen Projekten wird dieser Schritt zu oberflächlich angegangen. Es werden Lizenzen, Module und Implementierungskosten kalkuliert, aber kaum hinterfragt, welche Abläufe, Schnittstellen oder Entscheidungen das System überhaupt beeinflusst. Dabei ist der ROI immer das Ergebnis aus Veränderungspotenzial und Umsetzungsfähigkeit.
Ein praxisnaher Ausgangspunkt ist die Kombination aus:
- Prozesssicht: Welche Kernprozesse verursachen heute hohe manuelle Aufwände, lange Durchlaufzeiten oder Medienbrüche?
- Systemsicht: Welche dieser Probleme resultieren aus Systemgrenzen oder fehlender Integration?
- Organisationssicht: Wie reif ist die Organisation, um effizienter oder digitaler zu arbeiten – also: Sind Verantwortlichkeiten klar, Daten verlässlich, Abläufe stabil?
Diese drei Perspektiven sind nicht trennbar. Ein System kann nur so gut wirken, wie die Organisation bereit ist, seine Möglichkeiten zu nutzen. Umgekehrt nützt die beste Prozesslogik wenig, wenn das System sie technisch nicht trägt. Genau hier liegt der Kern der ROI-Betrachtung: Sie ist eine integrierte Analyse von Organisation und Technologie, nicht bloß eine Excel-Auswertung.
Vom Ist-Zustand zum Zielbild
Aus dieser Analyse entsteht ein realistisches Zielbild, also die Beschreibung eines angestrebten Soll-Zustands.
Dabei geht es nicht darum, das „perfekte“ System zu definieren, sondern ein denkbares, erreichbares Zukunftsbild:
Was könnte das Unternehmen mit einem modernen ERP-System leisten, wenn Prozesse, Daten und Verantwortlichkeiten konsequent ausgerichtet sind?
Dieses „gedachte Zielsystem“ hilft, Potenziale zu identifizieren und in Relation zu setzen – auch ohne schon zu wissen, welches konkrete ERP-System am Ende gewählt wird.
In der späteren Auswahlphase kann und sollte das dann verfeinert werden:
ERP A bietet möglicherweise stärkere Automatisierung in der Disposition, ERP B dafür Vorteile in Reporting und Integration.
So bleibt die ROI-Betrachtung dynamisch und realitätsnah.
Das Ziel: keine Schönrechnerei, sondern ein realistisches Delta
Entscheidend ist, dass die ROI-Betrachtung nicht dazu dient, ein Projekt zu „verkaufen“, sondern Verständnis zu schaffen:
- Welche Verbesserungen sind überhaupt erreichbar?
- Wie groß ist der organisatorische Aufwand, um sie zu realisieren?
- Und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit der ROI tatsächlich gehoben werden kann?
Eine sauber dokumentierte Ausgangslage schützt vor Illusionen und schafft die Grundlage für glaubwürdige Entscheidungen – sowohl im Management als auch in der Projektleitung.
Praxisbeispiel
Ein mittelständisches Fertigungsunternehmen wollte durch ein neues ERP-System „Kosten sparen“. Bei genauer Analyse zeigte sich: Die größten Effizienzverluste lagen nicht in Personalaufwänden, sondern in fehlenden Prozessdurchsichten, doppelter Datenerfassung und unzureichender Transparenz.
Das neue System konnte diese Punkte adressieren, aber erst, nachdem Rollen, Verantwortlichkeiten und Freigabeprozesse überarbeitet wurden.
Ergebnis: Kein Personalabbau – aber schnellere Durchlaufzeiten, verlässlichere Daten und besseres Controlling.
Der ROI entstand nicht durch Einsparung, sondern durch Stabilität und Geschwindigkeit.
Drei Ebenen der Wertschöpfung – wo ERP-Systeme echten Mehrwert schaffen
Der ROI eines ERP-Systems entsteht nicht aus einer Zahl, sondern aus der Fähigkeit, die richtigen Potenziale zu erkennen und zu nutzen. Diese Potenziale lassen sich in drei Ebenen gliedern: Prozesspotenziale, funktionale Potenziale und strukturelle Potenziale. Sie ergänzen sich und ergeben gemeinsam das Bild des möglichen Nutzens eines neuen Systems.
1. Prozesspotenziale – Effizienz im Ablauf
Prozesspotenziale zeigen sich dort, wo Arbeitsschritte heute manuell, mehrfach oder fehleranfällig sind.
Ein modernes ERP-System kann hier Abläufe vereinfachen, beschleunigen oder stabilisieren – etwa durch Workflow-Automatisierungen, bessere Datenflüsse oder klar definierte Zuständigkeiten.
Beispiel: Wenn Auftragsfreigaben bisher über Excel-Listen laufen und nun direkt im System erfolgen, verkürzt das nicht nur Durchlaufzeiten, sondern erhöht auch Transparenz und Nachvollziehbarkeit.
Der Nutzen entsteht dabei nicht nur in eingesparter Zeit, sondern in besserer Steuerbarkeit und geringeren Risiken.
Prozesspotenziale lassen sich gut anhand zweier Kriterien bewerten:
- Häufigkeit (wie oft tritt ein Prozess auf?)
- Hebel (welcher Nutzen entsteht, wenn er verbessert wird?)
So können auch qualitative Vorteile wie Zuverlässigkeit oder Kundenzufriedenheit in die Bewertung einfließen, ohne dass sie zwingend monetär beziffert werden müssen.
2. Funktionale Potenziale – neue Möglichkeiten schaffen
Während Prozesspotenziale Bestehendes verbessern, eröffnen funktionale Potenziale neue Wege der Arbeit.
Ein neues ERP-System bringt häufig Funktionen mit, die bisher gar nicht zur Verfügung standen – und dadurch Produktivität oder Qualität unmittelbar erhöhen.
Beispiele:
- Automatisiertes Einlesen von Eingangsrechnungen durch OCR-Technologie
- KI-gestützte Disposition oder Fertigungsplanung
- Automatische Adress- oder Bonitätsprüfung bei Auftragsanlage
- Integrierte Workflows zwischen Vertrieb, Produktion und Service
Solche Funktionen heben Potenziale, die zuvor manuell oder gar nicht bearbeitet werden konnten. Sie verändern Arbeitsweisen, Entscheidungsqualität und Geschwindigkeit – und bilden oft den größten Beitrag zum ROI eines modernen Systems.
3. Strukturelle Potenziale – das Fundament optimieren
Strukturelle Potenziale betreffen die Systemlandschaft, Daten und Integrationen. Sie sind weniger sichtbar, haben aber langfristig großen Einfluss auf Kosten und Stabilität.
Beispiele:
- Wegfall redundanter Systeme oder Schnittstellen
- Reduzierung manueller Datenimporte
- Niedrigere Wartungs- und Lizenzkosten durch Konsolidierung
- Einheitliche Datenbasis für Planung, Reporting und Analyse
Ein Unternehmen, das etwa drei Teilsysteme in einem zentralen ERP konsolidiert, spart nicht nur Lizenzgebühren, sondern gewinnt an Verlässlichkeit und Reaktionsfähigkeit. Diese strukturellen Effekte zeigen sich oft erst nach einiger Zeit, sind aber entscheidend für nachhaltigen ROI.
Der ROI als Potenzialbilanz, nicht als Rechnung
Der Wert einer ROI-Analyse liegt also nicht im Versuch, jede Zahl exakt zu beziffern, sondern darin, die Gesamtheit der Potenziale systematisch sichtbar zu machen.
Damit wird aus der ROI-Betrachtung keine theoretische Optimierung, sondern eine realistische Potenzialabschätzung, die Orientierung für Entscheidungen bietet – und die Grundlage für spätere Priorisierung in der Einführung schafft.
Je klarer diese Potenziale beschrieben und mit Verantwortlichkeiten verknüpft sind, desto größer ist die Chance, dass sie im Projekt tatsächlich realisiert werden.
Investitions- und Kostenseite – realistisch und ganzheitlich betrachten
Ein realistischer ROI entsteht nur, wenn Investitionen und Kosten vollständig und im richtigen Kontext betrachtet werden. Dazu gehört mehr als die Summe aus Lizenzen, Implementierung und Schulung. Ein ERP-Projekt beeinflusst Strukturen, Abläufe und Verantwortlichkeiten – und damit auch Aufwände, die in klassischen Kalkulationen oft übersehen werden.
1. Die Investitionsseite – mehr als Projektkosten
Die offensichtlichen Kostenpositionen sind meist schnell aufgelistet:
- Lizenz- oder Nutzungskosten (Cloud oder On-Premise)
- Implementierungs- und Anpassungsaufwand
- Datenmigration und Tests
- Schulung und Change Management
Doch auch hier lohnt ein genauerer Blick.
Gerade bei Cloud-Systemen werden die Investitionen über Nutzungsgebühren verteilt, was die Einstiegshürde senkt, aber langfristige Kostenstrukturen verändert.
On-Premise-Systeme erfordern höhere Anfangsinvestitionen, dafür geringere laufende Gebühren – bei größerer Verantwortung für Betrieb und Wartung.
Der ROI hängt also nicht nur vom System selbst ab, sondern auch vom gewählten Betriebsmodell.
Während Cloud-Systeme durch regelmäßige Updates schnellere Innovationszyklen ermöglichen (und so Nutzen früher realisieren können), bieten On-Premise-Modelle oft mehr Kontrolle, aber weniger Agilität.
Entscheidend ist, dass diese Unterschiede nicht nur finanziell, sondern strategisch bewertet werden:
- Wie stark will das Unternehmen eigene IT-Ressourcen binden?
- Wie wichtig sind Skalierbarkeit, Flexibilität oder Compliance-Aspekte?
- Und welche Form unterstützt am besten die geplanten organisatorischen Veränderungen?
2. Die Kostenseite – was häufig vergessen wird
Viele ROI-Betrachtungen unterschätzen die heutigen Systemkosten – und damit das Einsparpotenzial eines modernen ERP.
Diese „versteckten Aufwände“ zeigen sich in ganz unterschiedlichen Formen:
- Hoher Pflegeaufwand für alte Systeme oder Schnittstellen
- Lizenzkosten für Zusatzlösungen, die Basisfunktionen ersetzen sollen
- Sicherheits- oder Supportgebühren für veraltete Software (Out-of-Service-Systeme)
- Aufwand durch manuelle Datenpflege, Medienbrüche und fehlende Integration
Gerade diese Kosten sind entscheidend, weil sie oft stillschweigend im Alltag mitlaufen – und über Jahre zu erheblichen Belastungen führen.
Ein modernes System kann hier gleich doppelt wirken: Es reduziert direkte Kosten (z. B. durch Konsolidierung) und indirekte Aufwände (z. B. durch weniger Abstimmungen und Korrekturen).
3. Von der Kalkulation zur Perspektive
Der ROI ergibt sich also nicht aus einer punktuellen Rechnung, sondern aus der Differenz zwischen heutiger Belastung und zukünftigem Nutzen.
Er beschreibt den Grad, zu dem das neue System die Organisation befähigt, besser, schneller und sicherer zu arbeiten.
Ein Beispiel:
Zwei Systeme mögen auf dem Papier ähnliche Lizenzkosten haben – doch System A bietet integrierte Automatisierungen, System B nicht.
Das führt dazu, dass die tatsächliche Wirtschaftlichkeit von A deutlich höher ausfällt, obwohl die Anschaffungskosten vergleichbar sind.
Deshalb ist es sinnvoll, in einer frühen ROI-Betrachtung von einem gedachten Zielzustand auszugehen – und im Rahmen der Endauswahl zu prüfen, wie stark die jeweiligen Systeme diesen Zielzustand tatsächlich erreichen.
Wichtig: ROI entsteht erst durch Umsetzung
Auch die beste Kalkulation bleibt theoretisch, solange Prozesse, Rollen und Systeme nicht konsequent umgesetzt und genutzt werden.
Die eigentliche Wertschöpfung entsteht erst, wenn neue Funktionen wirklich eingesetzt, Schnittstellen aktiviert und organisatorische Routinen angepasst sind.
Ein Unternehmen, das nach der Einführung alte Arbeitsweisen beibehält, verliert den wirtschaftlichen Effekt – unabhängig davon, wie modern das System ist.
Deshalb gilt: ROI ist kein Projektergebnis, sondern ein Veränderungsergebnis.
Er wird dort gehoben, wo Technologie, Organisation und Menschen zusammenwirken – und die Veränderung tatsächlich gelebt wird.
Fazit – ROI entsteht durch Veränderung, nicht durch Berechnung
Der Return on Investment in ERP-Projekten ist kein Rechenergebnis, sondern ein Ergebnis von Veränderung.
Er spiegelt wider, wie gut ein Unternehmen seine technologischen, organisatorischen und prozessualen Potenziale miteinander verbindet.
Ein neues System allein schafft noch keinen Mehrwert – er entsteht erst, wenn Prozesse angepasst, neue Funktionen genutzt und Verantwortlichkeiten gelebt werden.
Wer ROI ernst nimmt, nutzt ihn nicht als Rechtfertigung für Budgets, sondern als Steuerungsinstrument für Nutzenrealisierung.
Er macht sichtbar, welche Effekte tatsächlich erreichbar sind, welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen und wo die Organisation sich selbst im Weg steht.
Ein realistischer ROI berücksichtigt dabei:
- die Ausgangssituation – Prozesse, Systeme und organisatorische Reife,
- die Potenziale – prozessuale, funktionale und strukturelle Verbesserungen,
- die Investitionen und laufenden Kosten – inklusive Betriebsmodell (Cloud, Hybrid, On-Premise),
- und die Veränderungsfähigkeit – den Grad, in dem die Organisation bereit ist, die neuen Möglichkeiten zu nutzen.
Gerade dieser letzte Punkt entscheidet über Erfolg oder Misserfolg.
Ein Unternehmen, das zwar investiert, aber alte Routinen beibehält, wird den ROI nie heben.
Wer dagegen Prozesse, Rollen und Kultur anpasst, kann denselben Investitionsbetrag mehrfach verzinsen – durch schnellere Abläufe, bessere Entscheidungen und höhere Transparenz.
Erfahrene, unabhängige Berater können hier entscheidend unterstützen:
Sie bringen den Blick von außen, um Annahmen zu validieren, realistische Potenziale zu quantifizieren und Zielbilder mit der organisatorischen Machbarkeit zu verbinden.
So wird die ROI-Analyse zu einem verbindenden Werkzeug zwischen Management, Projektteam und Fachbereichen – nicht als Kontrolle, sondern als gemeinsame Orientierung.
ROI-Canvas zur Berechnung der Vorteilhaftigkeit eines neuen ERP-Systems
Tragen Sie Ihre E-Mail ein und erhalten Sie sofort die Checkliste per Mail.
FAQ - ROI und ERP-Projekte
Warum wird der ROI von ERP-Projekten so oft falsch eingeschätzt?
Weil er zu eng gerechnet wird. Viele Unternehmen betrachten nur Lizenz- oder Implementierungskosten, nicht aber die Prozess- und Personaleffekte. Der wahre ROI entsteht aus Zeitgewinnen, Fehlerreduktion, Transparenz und Entscheidungsqualität. Diese Effekte sind messbar – aber nur, wenn man sie von Beginn an definiert. Wer früh Kennzahlen festlegt, kann nach Einführung valide bewerten, ob das Projekt wirtschaftlich erfolgreich ist
Wie lässt sich der ROI eines ERP-Projekts sinnvoll berechnen?
Durch eine Kombination aus TCO-Analyse (Total Cost of Ownership) und Wirkungsmodell:
- Kostenebene: Lizenzen, Implementierung, Betrieb, Schulungen, Change-Aufwand
- Nutzenebene: Prozesszeiten, Fehlerquoten, Durchsatz, Lagerbestände, Planungsqualität
Diese Größen werden in monetäre Effekte umgerechnet (z. B. Stundenersparnis × Personalkosten). So entsteht eine belastbare ROI-Kalkulation. Tools wie Find-Your-Software helfen, diese Kennzahlen strukturiert zu erfassen und Szenarien zu simulieren
Welche ROI-Ziele sind in ERP-Projekten realistisch?
In der Regel amortisieren sich ERP-Projekte nach 3 bis 5 Jahren. Der größte Hebel liegt in Prozessoptimierung und Vermeidung von Doppelarbeiten. Realistische Ziele entstehen, wenn Unternehmen nicht nur Kosten senken, sondern Transparenz und Steuerungsfähigkeit erhöhen. Moderne ERP-Systeme schaffen Mehrwert, indem sie Entscheidungszyklen verkürzen und Wachstum ermöglichen – ROI ist damit nicht nur finanziell, sondern auch strategisch zu verstehen
Wie kann man den ROI schon während der Auswahlphase beeinflussen?
Indem man früh Nutzenhypothesen und Kennzahlenziele definiert. Eine strukturierte Softwareauswahl – etwa mit Find-Your-Software – macht diese wirtschaftlichen Ziele von Anfang an messbar. So wird aus „Wir brauchen ein neues System“ ein Business Case mit nachweisbarem Mehrwert. Wer diese Denkweise schon in der Auswahl verankert, entscheidet datenbasiert und erhöht die Investitionssicherheit
Welche Fehler führen dazu, dass ERP-Projekte ihren ROI nicht erreichen?
- Fehlende Zieldefinition – kein klarer Business Case
- Zu technikzentrierte Umsetzung ohne Prozessneudenken
- Unterschätzter Change-Aufwand
- Fehlende Erfolgsmessung nach Go-Live
- Kein aktives Benefit-Tracking
Ein ROI entsteht nicht automatisch – er muss geführt und gemessen werden. Erfolgreiche Unternehmen verankern Controlling und Change-Monitoring fest im Projekt
Wie misst man den tatsächlichen ROI nach Go-Live?
Durch ein strukturiertes Benefit-Tracking-Modell:
- Soll-Werte aus der Projektdefinition (z. B. Durchlaufzeiten, Bestände, Fehlerraten)
- Ist-Werte aus den ersten Betriebsmonaten
- Abweichungsanalyse mit Verantwortlichkeiten
So lassen sich wirtschaftliche Effekte belegen und Lerneffekte dokumentieren. Tools wie Find-Your-Software oder BI-Systeme können diese Metriken automatisch verknüpfen und Trends visualisieren – ein entscheidender Beitrag zur Projekttransparenz
Warum ist ROI kein einmaliger Kennwert, sondern ein Steuerungsinstrument?
Weil ERP-Systeme sich mit dem Unternehmen weiterentwickeln. ROI ist nicht das Endergebnis, sondern eine laufende Managementgröße. Er zeigt, ob sich Investitionen in Prozesse, Datenqualität und Automatisierung lohnen – und wo Potenzial ungenutzt bleibt. Unternehmen, die ROI als Steuerungsgröße verstehen, nutzen ihr ERP-System aktiv zur Performance-Steuerung, nicht nur zur Datenerfassung
Quellen
- Gartner. (2023). ERP Value Realization: Measuring What Matters Beyond Cost. Gartner Research Report.
- Deloitte. (2024). Unlocking ERP ROI: From Cost Savings to Capability Gains. Deloitte Insights.
- IDC. (2023). Comparing ERP Investment Value Across Vendors. IDC Whitepaper.
- McKinsey & Company. (2024). Realizing the Value of Enterprise Technology: Change as the ROI Multiplier.McKinsey Digital Paper.